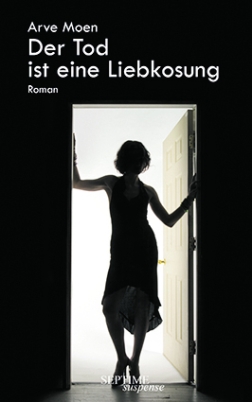© Preußische Allgemeine Zeitung / Folge 39-11 vom 01. Oktober 2011
Die ostpreußische Familie Lewe Landslied, es ist Erntedanktag, und wenn dieses Jahr auch für viele Landwirte kein gutes ist, werden die Kirchen geschmückt mit den Früchten von Feld und Garten, und wir werden dankbar sein, dass wir in einem Land leben, in dem es keine Hungersnot gibt. Unsere Vorfahren hatten es da schwerer, Missernten waren kaum zu verkraften und es gab Zeiten, da waren ganze Landstriche „wüst“ geworden, weil durch Krieg und Seuchen die Menschen dahin gerafft waren und die Äcker unbestellt blieben. Umso mehr ehrte man das tägliche Brot. Von Kindheit an wurde man belehrt, dass man keine Ähren zertreten durfte. Die Mutter machte drei Kreuze über den Brotlaib, ehe er in den Ofen geschoben wurde. Und im guten alten Platt wurde der Spruch gesagt: „Dat Brot is em Oawe, de leewe Gottke is bowe!“ Das bedeutete, dass der liebe Gott von „oben“ seinen Segen spendete. Brauchtum, das sich bis in unsere Zeit erhalten hatte, wie das Wasserschwauksen beim Plon, dem masurischen Erntefest, wie die Erntekrone, wie die mit Blumen geschmückten Sensen. Und in manchen Höfen zwischen Memel und Pregel hing in der Gesindestube noch der „Bobas“, das letzte Ährenbündel, aus dem ein paar Körner in die nächste Aussaat getan wurden – das sollte eine gute Ernte bringen. Und weil auch wir dankbar sein können, dass wir als „Ostpreußische Familie“ so fest zusammen halten und jetzt schon feststellen können, dass wir auch in diesem Jahr eine gute Ernte einfahren – nämlich Erfolge, die für manche Neu-Leser ein Rätsel sind –, möchte ich aus der heutigen Ausgabe ein kleines Erntefest machen. Ich habe seit langem zwei Geschichten liegen, die ich zwar vom Thema her schon behandelt habe, aber eben nur teilweise. Und sie passen so gut zu diesem Tag, denn sie berichten von Acker und Feld, von Korn und Brot – und von ostpreußischen Schicksalen. Da ist die Geschichte von dem Roten Mohn, die uns Herr Rolf Müller aus Weetze zugesandt hatte. Ich hatte sie in Kurzform in der Folge 18 veröffentlicht mit der Frage, wer sie kenne, wer von ihr gehört oder sie gelesen habe. Es war nämlich ungewiss, ob das darin geschilderte Wiederfinden wirklich geschehen war oder ob es sich um eine Erzählung handelte. Herr Müller erhielt bisher leider keine erklärende Antwort, gibt aber die Hoffnung nicht auf. Er übersandte uns die Geschichte in epischer Form und gleichzeitig das Foto eines Gemäldes, das ein mit ihm befreundeter Maler geschaffen hatte. Ein schöneres Bild hätten wir uns für unsere Erntedank-Ausgabe nicht wünschen können. Ich lasse Rolf Müller erzählen: „In der Nacht hatte es ein Gewitter gegeben. Noch am Morgen zerrissen Blitze den sich langsam erhellenden Himmel. Seit Tagen, seit Wochen hatten Menschen, Pflanzen und Tiere das kostbare Nass herbeigesehnt und nahmen es nun begierig auf. Allmählich ließen die Schauer nach, und kühle, frische Luft lockte zu einem Gang durch die nahe liegenden Felder. Der Wind hatte die schweren Regenwolken auseinander gerissen und nun bahnten sich die ersten Strahlen der Morgensonne ihren Weg zur Erde. Schweigend gingen die beiden Spaziergänger nebeneinander her. Sie genossen den Blick über die Getreidefelder, deren Ähren sich unter der Schwere der gereiften Frucht und den Regentropfen beugten. In sattem Gelb leuchteten die reifen Körner, und die immer intensiver werdenden Strahlen der Sonne verliehen dem Spiel der Farben Kraft. Zahlreiche Geschichten hatte der ältere der beiden Wanderer dem Freund aus seinem ereignisreichen Leben erzählt, doch diesmal schwieg er, um die aufatmende, erwachende Natur in sich aufzunehmen. Ich weiß nicht, wie lange sie so still nebeneinander gegangen waren, als eine Schneise mitten im Getreidefeld ihren Blick auf sich zog. Sie war dicht übersät mit zahllosen Mohnblumen. Noch neigten sich die Blüten unter der Last des nächtlichen Regens, doch die Sonnenwärme saugte die Feuchtigkeit von den zarten Blütenblättern, deren Rottöne in allen Nuancen leuchteten. Bei diesem Anblick brach der Ältere das Schweigen, die Mohnblüten hatten ihm eine Geschichte entlockt, die er nun seinem Freunde erzählte: Es war in den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg, da wuchsen im masurischen Teil Ostpreußens zwei Geschwister auf – ein Junge und ein Mädchen. Bei dem Jungen gab es ein kleines Merkmal, das aber nicht besonders auffiel. Er hatte ein ausgeprägtes Gespür für Farben, und so faszinierte ihn das Rot der Mohnblumen, die der Landschaft im Sommer das charakteristische Bild verliehen. Immer wieder versuchte er, mit seinen kindgemäßen Techniken und Materialien die Schönheit der Mohnblumen in Bildern festzuhalten, die auch seine Umgebung erstaunen ließen. Doch diese glückliche Kindheit wurde jäh zerstört, als 1944/45 die große Flucht begann, bei der die Familie auseinander gerissen wurde. Das heranwachsende Mädchen gelangte in den Westen und versuchte, Eltern und Bruder zu finden – vergebens! Irgendwann heiratete sie, und ein Junge kam zur Welt. Eines Tages brachte das Kind aus der Schule ein Bild von gezeichneten Mohnblumen mit. Aufgeregt fragte die Mutter ihren Sohn nach der Herkunft des Bildes, denn die Ähnlichkeit zu den Bildern aus der Vergangenheit war verblüffend. Sein Lehrer hatte die Bilder gezeigt und ausführlich vom roten Mohn und seiner Jugend in Ostpreußen erzählt. Mit Herzklopfen eilte die Mutter mit ihrem Sohn zur Schule, obgleich ihr der Name des Lehrers nichts besagte. Als sie sich gegenüberstanden versuchte sie, irgendeine Ähnlichkeit in seinen Gesichtszügen zu entdecken. Der Lehrer erklärte, dass er den Namen seiner Pflegeeltern angenommen hätte, da er ein Findelkind aus Ostpreußen sei. Erinnerungen an seine Familie habe er nicht. Als sie ihn bat, hinter sein linkes Ohrläppchen schauen zu dürfen, wurde ihre Ahnung zur Gewissheit: Das Muttermal, das ihn seit seiner Geburt kennzeichnete, war deutlich zu erkennen. Vor ihr stand ihr Bruder. Überglücklich fielen sie sich in die Arme – nach langen Jahren des Suchens hatten die Geschwister zueinander gefunden. Schweigend hatte der jüngere Wanderer dem Erzähler zugehört. Sein Blick schweifte über das Kornfeld, aus dem sich an der Stelle, an der sie gerade standen, eine Mohnpflanze erhob: Das Schwarz der Mitte kontrastierte mit dem leuchtenden Rot der zarten Blütenblätter. Schon während des Zuhörens war vor seinem inneren Auge das Bild des leuchtenden Mohns im Kornfeld entstanden, nun sah er es verwirklicht. Daheim griff er zu Pinsel und Farben und ließ es auf der Leinwand entstehen.“ Hier ist es, das Mohnbild des Weezer Malers Enzo Sacco, und erweckt in uns Erinnerungen. Vielleicht kennt jemand diese Begebenheit und kann Auskunft geben, ob sie sich tatsächlich so zugetragen hat. Herr Rolf Müller, dessen verstorbene Frau Gertrud ebenfalls ihre Kindheit in Ostpreußen verlebte, hatte ihrem Mann von diesem wundersamen Wiederfinden erzählt, an das er sich bei der Wanderung durch die Kornfelder erinnerte und das er jetzt für uns aufgeschrieben hat. Das ist die eine Geschichte, die ich für diese Ausgabe zurückgelegt hatte – die andere ist die von der Baronesse Margaretha von der Ropp und ihrem „Lehndorff-Brot“, die wir in der Osternummer (Folge 16) veröffentlichten. Sie ist eine wahre Geschichte und handelt von einer Frau, die sich durch nichts und niemand von ihrem Weg abbringen ließ und mit 70 Jahren noch ein Unternehmen gründete, mit dem sie ihre Ideen und Kenntnisse verwirklichen konnte. Mit dem von ihr entwickelten Brot aus Roggenflocken war sie den heutigen Bestrebungen für gesunde Ernährung weit voraus. Sie erntete große Erfolge und ließ sich auch durch Querschläge nicht entmutigen. Wir hatten über diese Entwicklung von den Anfängen in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts, als die aus dem Baltikum vertriebene Baronesse auf dem Gut Lehndorff im samländischen Kirchspiel Wargen mit dem Brotbacken nach einem Geheimrezept ihrer Familie begann, über ihre frühen Erfolge in Ostpreußen, Vertreibung und Neubeginn bis zu der heutigen Situation in der Osterausgabe kurz berichtet, konnten aber nicht näher auf ihr Leben nach der Flucht und ihre Arbeit in der Nachkriegszeit eingehen. Herr Heinrich Lohmann, der als Biograf der Margaretha von der Ropp unsere Ostpreußische Familie vor neun Jahren um Mithilfe gebeten hatte – mit gutem Erfolg! – übersandte uns zum Dank ihre Lebensgeschichte, die wir nun weiterführen wollen. Die Baronesse, 1893 in Litauen geboren, hatte auf dem Lehndorff-Gut ein reiches Arbeitsfeld gefunden, nicht nur in dem Bäckereibetrieb, sondern auch in der Mitwirkung an der Vollblut-Pferdezucht des Grafen. Diese Partnerschaft fand schon vor der Flucht ein Ende, als der älteste Sohn des Grafen, Heinrich von Lehndorff, als Mitverschwörer des 20. Juli hingerichtet wurde. Sogar die Baronesse wurde kurzfristig festgenommen und verhört. Vor der Roten Armee konnte sie mit den Lehndorffs fliehen, sie fanden Zuflucht bei Verwandten im Fichtenhof in Bremen. Margaretha arbeitete als Fuhrunternehmerin und bei Bauern. Im Sommer 1946 bemühte sie sich beim Bremer Senat um die Genehmigung für einen Backbetrieb. Anscheinend vergeblich, denn sie wechselte in den hauptamtlichen Dienst der bremischen evangelischen Kirche, wo sie sich bis zum 70. Lebensjahr unermüdlich um Menschen in Not kümmerte und ihnen Mut gab. „Fangt an, fangt an!“ war ihr Motto, nach dem sie selber lebte, denn nach der Erreichung des Rentenalters im Jahr 1963 und dem damit verbundenen Ausscheiden aus der aktiven Arbeit gründete sie die „Lehndorff Brot GmbH“, um endlich wieder das Brot backen zu können, nach dem sie immer wieder gefragt worden war. Fünf Jahre vorher hatte sie schon begonnen, eine Mühle zu suchen, die bereit war, die Roggenflocken nach ihren Angaben herzustellen. Sie fand diese in der Mühle in Stemmen, Kreis Verden. In einem Exklusivvertrag wurde festgelegt, dass die „Lehndorff-Flocken“ ausschließlich hier nach ihren Angaben produziert und nur an die von ihr benannte Bäckerei geliefert werden durften. Das Recht, den Namen „Lehndorff“ zu verwenden, hatte ihr Manfred Graf von Lehndorff bereits 1959 erteilt. Eine Namenskartei der ehemaligen Kunden war vorhanden. Doch woher das benötigte Stammkapital von 20000 D-Mark nehmen? Keine Bank gab doch einer 70-jährigen für eine vage Geschäftsidee ein solches Darlehen. Die Hilfe kam von der Witwe des hingerichteten Grafen, die ihr das Geld leihweise zur Verfügung stellte. Es wurde eine Bäckerei in Bremen-Hemelingen gemietet, ein Meister eingestellt. 1963 startete das Unternehmen – und war nach einem Jahr pleite. Eine andere als die 70-jährige Margaretha von der Ropp hätte jetzt kapituliert – sie nicht! In Bremen hatte der junge Manfred Tenter die „Bremer Brotfabrik“ seines Vaters übernommen. Er erklärte sich bereit, dieses spezielle Backverfahren in seinem Betrieb anzuwenden, so kam es zum Vertragsabschluss. Voraussetzung für den Verkaufserfolg waren einwandfreie Flocken. Die Produktion erwies sich als sehr zeit- und arbeitsintensiv. Ausgangspunkt war ausgesuchter, vollkörniger Petkus-Roggen, der in drei aufwendigen Verfahren gereinigt wurde. Die Roggenflocken wurden nicht durch Mahlen, sondern durch ein Quetschen des Getreidekorns erzeugt. Dadurch bleiben dem Korn sämtliche Bestandteile erhalten. In der Mühle in Stemmen erinnert man sich noch heute an die 16-Stunden-Tage, an denen die Produktentwickler, zu denen auch ein Ostpreuße gehörte, mit der Baronesse arbeiteten. Mit Erfolg, denn in den 70er Jahren wurde das „Lehndorff-Brot“ zur führenden Brotsorte der Hansestadt. Die Herstellung erfolgte und erfolgt noch heute nach dem Geheimrezept der Margaretha von der Ropp, das die Bäckerei „Tenter’s Backhaus“ nicht preisgibt. Nachahmungen hat es viele geben, sie kamen nie an das „echte Lehndorff’sche“ heran. Die Frau, die es entwickelt hat, verstarb am 11. Oktober 1974 an den Folgen eines Oberschenkelhalsbruches. Von ihr und ihrer Lebensernte, die sie allen Widerständen zum Trotz in reichem Maße einbringen konnte, zu berichten war ein echtes Anliegen von Herrn Heinrich Lohmann – auch das unsere. Übrigens hat sie uns noch einen guten Tipp hinterlassen: Verpacktes Brot immer einige Stunden offen liegen lassen. „Dann kommt erst das Aroma in das Brot“, war ihre Erfahrung. Eure Ruth Geede |
| Artikel ausdrucken | Probeabobestellen | Registrieren |