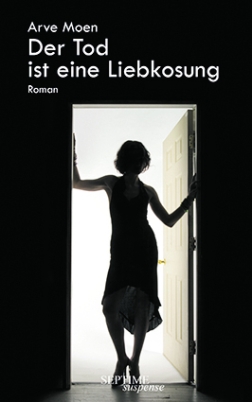Als am 12. August 2000 das damals modernste Atom-U-Boot der Nordflotte Russlands während einer Übung im Becken der Barentssee nach zwei Explosionen versank, kamen alle 118 Besatzungsangehörigen ums Leben. 95 von ihnen waren auf der Stelle tot, die anderen konnten sich in die Hecksektion retten, wo sie Stunden später den Erstickungstod fanden. Ihr Schicksal bewegt die Menschen bis heute.
Am Ende des Ersten Weltkrieges war mein Vater Kommandant eines U-Bootes. Eigentlich hatte er Archäologe werden wollen. Vielleicht war das der Grund, warum er über seine Kriegserlebnisse selten sprach und über seine U-Boot-Zeit noch seltener. Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang nur an einen einzigen Satz, nämlich den: „Wenn wir vor Wasserbomben wegtauchen mussten und deshalb in größere Tiefe gingen, fing der Stahl wegen des Wasserdrucks an zu knirschen – das war ein unangenehmes Geräusch.“ Als mein Vater dies berichtete, tobte schon der Zweite Weltkrieg.
Heute ist es für mich weder fassbar noch nachvollziehbar, sondern fast irre: Ein Junge (ich) zwischen dem 7. und 13. Lebensjahr träumte davon, er werde im Krieg „fallen“ (das Wort klang nicht so negativ wie „sterben“). War ein solcher Tagtraum damals gewöhnlich oder ungewöhnlich, verbreitet oder vereinzelt? War es nur eine Version pubertärer Todessehnsucht? Oder handelte es sich um ein Produkt der Propaganda, der Lektüre von Landserheften, die, weil sie nummeriert waren, vollständig angeschafft wurden, damit keine Lücke in der Reihe entstand, oder des Eindruckes der Titelbilder von Illustrierten oder der markigen Filme der „Deutschen Wochenschau“ oder der Fanfarenklänge vor der Verkündung der „Sondermeldungen“ im Rundfunk über militärische Erfolge? Hat das in jener Zeit gebräuchliche Wort „Heldentod“ vielleicht die Gefühlswelt der damaligen Jungengeneration beeinflusst, auch wenn dieser Ausdruck wohl nicht zum Sprachgebrauch des Kindes gehörte?
Ich weiß es nicht; aber ich erinnere mich genau: Das Faktum – ein früher Tod – stand fest (so schien es), nur das Wie und Wann und Wo waren unbestimmt. Falls man damals einen diesbezüglichen Wunsch hätte äußern können, war es dieser: Bitte nicht in einem U-Boot „absaufen“, sondern „wenn es passiert“, die Sonne oder den Himmel noch einmal sehen, vielleicht so, wie es viele Jahre später der russische Kultfilm „Wenn die Kraniche ziehen“ aus der Sicht eines sterbenden russischen Soldaten zeigte: Die Wipfel der Bäume drehen sich, alles wird unscharf, das Licht wird matt und verschwimmt – so ungefähr könnte die letzte Stunde aussehen, aber eben bitte im Freien, auf der Erde, nicht unter Wasser in einem stählernen Sarg.
Was wussten wir deutschen Schuljungen damals, also während des Krieges, von russischen U-Booten? Für mich selbst kann ich die Frage mit einem Wort beantworten: nichts. Russlands Marine? Viele von uns hatten Frank Thiess’ Roman „Tsushima“ gelesen, zu jener Zeit ein Bestseller, der den langen Marsch der zaristischen Flotte bis in das nasse Grab in der Seeschlacht mit den Japanern von 1905 schilderte; aber U-Boote kommen darin nach meiner Erinnerung nicht vor. Von der Versenkung des mit Flüchtlingen (vor allem aus Ostpreußen) vollbeladenen Schiffs „Wilhelm Gustloff“ durch ein russisches U-Boot in der Ostsee, wodurch Tausende den Tod fanden, erfuhren die meisten von uns erst nach dem 8. Mai 1945.
Jedenfalls ist der Untergang eines U-Bootes im Krieg nichts Ungewöhnliches, sondern fast – ein makabres Wort – etwas Normales. Von den im Zweiten Weltkrieg zum Einsatz gekommenen 859 U-Booten der deutschen Kriegsmarine gingen 648 Boote auf Feindfahrt verloren, davon 429 mit der gesamten Besatzung. Etwa 30000 U-Boot-Fahrer kehrten nicht zurück, was einer Verlustrate von 60 Prozent entspricht (Angaben bei Werner Rahn, in: „Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg“, Band 10/1, 2008, Seite 149). In Friedenszeiten ist dagegen der Untergang eines U-Bootes ein Unglücksfall besonderer Art. Dies dokumentierte schon der Verlust des zwischen den beiden Weltkriegen im Ärmelkanal vor Liverpool gesunkenen britischen U-Bootes „Thetis“ mit 99 Toten, noch mehr aber der Untergang des russischen U-Bootes „Kursk“ in der Barentssee am 12. August 2000.
Das Unglücks-U-Boot vom Jahr 2000 war nach der mittelgroßen russischen Stadt benannt, die als Ort der „Panzerschlacht von Kursk“ historische Bedeutung erlangt hat. Am 5. Juli 1943 begann die Schlacht, die 50 Tage dauern sollte, und an der zirka drei Millionen Soldaten mit mehr als 10000 Panzern und Selbstfahrlafetten sowie 8000 Flugzeugen teilnahmen. Der „Völkische Beobachter“ berichtete damals von einer „Materialschlacht größten Ausmaßes“ und von einer „Bereitstellung der gewaltigsten Kampfmittel, welche die Ostfront jemals erlebt hat“. In der „schwersten Panzerschlacht der Geschichte“ und einer der „tödlichsten Schlachten des gesamten Krieges“, so die britische Historikerin Catherine Merridale in ihrem Buch „Iwans Krieg. Die Rote Armee 1939–1945“, waren nach deutschen Angaben schon wenige Tage nach Beginn der deutschen Offensive 1227 sowjetische Panzer vernichtet worden, „während die Panzerverluste auf deutscher Seite gering sind“. Tatsächlich war aber der deutsche Angriffsschwung schon bald in einer tiefgestaffelten sowjetischen Verteidigungslinie zum Stehen gebracht worden; diese aufzubauen hatte die Rote Armee Zeit gefunden, weil „der größte Feldherr aller Zeiten“ gegen den Rat der Militärs den Beginn der unter dem Codewort „Zitadelle“ geplanten deutschen Offensive mehrmals verschoben hatte. Bald war nur noch von „schweren Abwehrkämpfen“, von „offensiver Defensive“ und von „Frontbegradigung“ auf deutscher Seite die Rede. Am 23. August räumten die deutschen Truppen Charkow. Damit war das Ereignis beendet, das Roman Töppel im Untertitel seines kürzlich erschienenen Buches „Kursk 1943“ als die „größte Schlacht des Zweiten Weltkrieges“ bezeichnet; im Vorwort findet sich das Zitat: wahrscheinlich sogar die „größte Schlacht der Geschichte.“
Mit dem Gebrauch von solchen Superlativen sollte man vorsichtig sein. Unzweifelhaft kann jedoch der Untergang der „Kursk“ als einer der größten Unglücksfälle in der Geschichte der U-Boote genannt werden. Dieses Urteil gründet nicht nur auf der hohen Zahl von 118 Toten, sondern auch auf dem Faktum, dass es sich bei der „Kursk“ um ein atomgetriebenes U-Boot handelte, an dessen Bord sich zwei Atomreaktoren befanden, die bis zu 1,5 Tonnen hoch angereichtes Uran enthielten – mit all dem daraus folgenden Gefährdungspotenzial. Die 1994 unter der Typenbezeichnung K-141 vom Stapel gelaufene „Kursk“ war mit ihrer Länge von 154 Metern und einer Breite von 18 Metern zum Zeitpunkt ihres Unterganges eines der größten und modernsten im Betrieb befindlichen U-Boote.
Als in Betracht kommende Ursachen des Unglückes nannte die mit der Aufklärung beauftragte russische Regierungskommission drei Möglichkeiten, nämlich eine Explosion an Bord der „Kursk“, ein Auffahren des Bootes auf eine Mine aus dem Zweiten Weltkrieg oder ein Zusammenstoß mit einem ausländischen U-Boot. Von offizieller russischer Seite wurde die letztgenannte Möglichkeit zunächst favorisiert, dies, obwohl das dafür notwendige fremde „Objekt“ fehlte. Zurückgewiesen wurde dagegen die von einigen Fachleuten geäußerte Vermutung, der in dem betreffenden Seegebiet operierende russische Kreuzer „Peter der Große“ habe durch einen Fehler in der Manöverplanung die „Kursk“ versehentlich getroffen. Am Ende der Spekulationen blieb als wahrscheinlichste Ursache eine Explosion in dem mit Torpedos und Raketen bestückten Schiff.
Dem Kapitän der „Kursk“ verlieh Präsident Wladimir Putin postum die Auszeichnung „Held Russlands“, die anderen 117 Opfer erhielten Tapferkeitsmedaillen. Diese Geste vermochte die Trauer und die Wut der Hinterbliebenen nicht zu mindern, denen sich Putin bei einem Treffen mit Angehörigen der Opfer im Marineklub der Garnison Widjajewo stellte. Fragen nach Schuld und Bestrafung der Verantwortlichen blieben unbeantwortet. Jedoch versprach Putin eine Bergung der toten Seeleute und eine Hebung des Wracks. Tatsächlich hatten Taucher einer von Russland beauftragten britisch-norwegischen Spezialfirma schon eine Woche nach dem Untergang die hintere Rettungsluke der in 108 Meter Tiefe liegenden „Kursk“ geöffnet und festgestellt, dass sich keine Überlebenden an Bord befanden. Ein Jahr später – im Oktober 2001 – wurde das Wrack mit westlicher Hilfe, weil der Kalte Krieg schon seit etlichen Jahren beendet war, in einer 19 Stunden währenden Aktion gehoben.