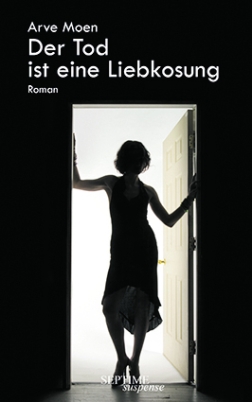Zusammen mit Volker Münz und Thomas Wawerka hat der Politikwissenschaftler und katholische Theologe Felix Dirsch das Buch „Rechtes Christentum?“ herausgegeben. Es setzt sich kritisch mit Teilen der offiziellen Politik der deutschen Amtskirchen auseinander und opponiert gegen eine einseitige Politisierung von links. Der Sammelband plädiert für eine differenzierte Sichtweise des Christentums und zeigt dabei auf, dass es eine Fülle von traditionsbewussten und konservativen Bausteinen in diesem Glaubensbereich gibt. Bernd Kallina hat mit Felix Dirsch über seine Thesen gesprochen.
PAZ: Warum haben Sie das Buch initiiert?
Felix Dirsch: Zunächst haben wir das Buch geschrieben, weil in der Öffentlichkeit eine irreführende Meinung vorherrscht. Es dominiert nämlich der Eindruck, als ob heute christliches Gedankengut nur mit linksideologischen, sprich universalistischen, Orientierungen vereinbar wäre. Das ist jedoch nicht der Fall. Es gab und gibt auch ganz andere Strömungen, beispielsweise „rechte“. Wichtig ist die Erkenntnis, dass man den christlichen Glauben nicht eins zu eins auf Politik übertragen kann, schon gar nicht exklusiv auf linke Politik. Die globalistisch-universalistische Agenda ist sicher nur eine Variante, die sich aus christlichen Quellen ergeben kann. Es gibt jedoch auch ein volks- und heimatnahes Christentum. Schließlich war Jesus sehr eng mit seinem Volk verbunden, er stand treu zu seiner Herkunft. „Rechtes“ Christentum ist „richtiges“ Christentum im Sinne des Apostolikums: „Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters.“
PAZ: Es herrscht der Eindruck vor, dass christliche Kirchentage der letzten Jahre oftmals eher rot-grünen Parteitagen gleichen, als bibelorientierten Versammlungen von Gläubigen. Woher kommt dieser Trend?
Dirsch: Dieser Trend kommt hauptsächlich aus der gesellschaftlichen Linksverschiebung seit den 1960er und 1970er Jahren in Deutschland. Er zeigt sich in der EKD weitaus deutlicher als in der katholischen Kirche. Ein Grund besteht darin, dass es bei den Protestanten kein einheitliches Lehramt gibt wie in der katholischen Kirche. Letzteres legt die Grundprinzipien des Glaubens fest, und diese können nicht so einfach auf rot-grüne Politforderungen verkürzt werden. Hinzu kommt, dass der Protestantismus erheblich stärker in die Verbrechen des Nationalsozialismus involviert war, woraus sich ein quasi-religiöser Schuldkomplex im Rahmen einer immerwährenden Vergangenheitsbewältigung herausgebildet hat. Ehemals starke konservative Bastionen sind in der EKD lange verschwunden, wenn man beispielsweise an Persönlichkeiten denkt wie Alexander Everts, Eugen Gerstenmaier, Hermann Ehlers oder die „Notgemeinschaft evangelischer Christen“.
PAZ: Ein Vorwurf dieser konservativen Gruppen besteht darin, dass die links-politischen Aktivitäten der Kirchen auf Kosten der seelsorgerischen Arbeit gingen. Besteht dieser Einwand zu Recht?
Dirsch: Ja, es gibt eine starke Verweltlichung in der gesamten Gesellschaft, eine starke Säkularisierung. Große Teile unserer Kirchen nehmen diese Säkularisierung affirmativ hin. Sie meinen, dass man mit traditioneller seelsorgerlicher Arbeit, die am Heil des Einzelnen orientiert ist, nichts mehr gewinnen könne und ersetzen sie durch Politisierung. Insbesondere durch einen sehr starken Humanitarismus. Es handelt sich bei dieser Variante um eine moralisierende Verfallserscheinung eines echten Humanismus. Nicht mehr Gott steht dann im Mittelpunkt der Seelsorge, sondern der Mensch in seiner sozialen Stellung. Diese Verkürzung ist höchstens als ein „Schwundstufenchristentum“ zu begreifen.
PAZ: Der Soziologe Helmut Schelsky beschrieb diesen säkularen Entwicklungs-Trend schon in den 1970er Jahren als einen Prozess, der „vom Seelenheil zum Sozialheil“ führt.
Dirsch: So kann man diesen Trend sehr gut beschreiben, Schelsky hat ihn früh erkannt.
PAZ: Wäre es aber nicht gerade Aufgabe christlicher Kirchen, diese seelsorgerischen Orientierungen wieder in den Mittelpunkt ihrer Tätigkeiten zu stellen?
Dirsch: Ja. Aber man darf nicht unterschätzen, dass diese Wende ein mühsames Unterfangen darstellt. Denn wenn der christliche Glauben einer größeren Zahl von Menschen verloren gegangen ist, dann erscheint eine Rechristianisierung als sehr schwierig. In Einzelfällen mag es Bekehrungserlebnisse geben, doch das sind Ausnahmen. Es gibt sicherlich ein neues Interesse am Glauben. Doch die Amtskirchen wollen den Glaubensverlust lieber durch soziales und humanitaristisches Engagement wettmachen, um damit anschlussfähig in unserer säkularen Gesellschaft zu bleiben.
PAZ: Der Literaturwissenschaftler und Schriftsteller Rüdiger Safranski hat in seinem Buch „Wieviel Globalisierung verträgt der Mensch?“, geschrieben: „Je mehr emotional gesättigte Ortsbindung, desto größer die Fähigkeit und Bereitschaft zur Weltoffenheit“, also nicht umgekehrt. Wie sehen Sie das?
Dirsch: Ich stimme Safranski zu. Er zeigt realpolitischen Sinn für menschliche Verwurzelungs-Bedürfnisse, die prägend sind, Sicherheit vermitteln und somit die Grundlagen für Weltoffenheit bestimmen. Andererseits berühren wir hier die Bipolarität des Christentums in diesen Fragen von Heimat, Ortsbindung und Globalisierung. Wie schon erwähnt, gibt es sowohl die universalistische, aber auch die ortsgebundene, die nationale Ausrichtung. Die Frage ist aber, wenn wir an das Wohl der betroffenen Menschen denken, in welchem Verhältnis stehen die beiden Pole zueinander? Heute kommt von den Amtskirchen nur die eine Botschaft des Universalismus, die natürlich in der Bibel, etwa im Gleichnis vom barmherzigen Samariter, gewisse Anhaltspunkte findet. Das erscheint mir aber zu wenig. Denn es gab traditionell auch Stellungnahmen von Kirchenführern, die auf die Pflicht des Christen verwiesen haben, Volk und Vaterland zu lieben.
PAZ: Nennen Sie doch einige dieser Beispiele.
Dirsch: Beispielsweise der berühmte NS-Gegner Bischof von Galen, auch bekannt geworden durch seine Anti-Euthanasie-Predigten. Er sagte einem US-amerikanischen Offizier, der ihn in den Nachkriegsjahren verhörte: „Ich leide sehr an dem Zustand meines Volkes.“ Oder der Kölner Oberhirte Kardinal Frings, der nicht nur die Verbrechen des Nationalsozialismus scharf verurteilte, sondern auch die Untaten der Besatzungsmächte. Sämtlichen Kollektivschuldvorwürfen erteilte er eine strikte Absage. 1958 sprach Papst Pius XII. vom „harmonischen Dreiklang von Heimatliebe, Vaterlandsliebe und Liebe zur Kirche“. Dann könnte man eine Verlautbarung des Zweiten Vatikanums zitieren, die zu einer „hochherzigen und treuen Vaterlandsliebe“ ohne geistige Enge auffordert. Bis Mitte der 1960er Jahre war es in den Gottesdiensten selbstverständlich, den Segen Gottes für Volk und Vaterland zu erflehen. 1985 stellte der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz, Joseph Kardinal Höffner, den Zusammenhang von Gottesglaube und Heimatverwurzelung heraus: „Nach christlichem Verständnis gründet die Liebe zum Vaterland in der ehrfürchtigen Hingabe jenen gegenüber, denen wir unseren Ursprung verdanken: Gott, unseren Eltern und dem Land unserer Väter, wo unsere Wiege stand, dem Land, dem wir durch die gemeinsame Heimat, die gemeinsame Abstammung, die gemeinsame Geschichte, die gemeinsame Kultur, die gemeinsame Sprache schicksalhaft verbunden sind.“
PAZ: Der Altmeister der deutschen Soziologie, Max Weber, diagnostizierte auf dem Feld moralischer Orientierungen die Spannung zwischen Gesinnungs- versus Verantwortungsethik. Damit meinte er, dass die Gesinnungsethiker edle Ziele verkündeten ohne sich um deren oft negativen Folgen zu kümmern, während die Verantwortungsethiker die realpolitischen Konsequenzen stets im Auge behielten und damit viel Unheil verhinderten. Konkret: Kann man mit einer wörtlich genommenen Bergpredigt gerechte Politik betreiben?
Dirsch: Die Frage taucht immer wieder auf. Für wen gilt die Bergpredigt? Ist sie direkte Maxime an die Politik? Oder ist sie nur die Ethik für einen bestimmten Stand? Also für Leute, welche die christliche Botschaft qua Beruf oder christlichem Leben eins zu eins verwirklichen wollen. Viele haben gesagt, nein, das kann man nicht in der Politik umsetzen, weil hier andere Bedingungen gegeben sind. Das radikale Christen-Leben führt dann – frei nach Max Weber – zu einer reinen Gesinnungsethik, wenn ich versuche, es wörtlich umzusetzen. Staatspolitisch geht das allerdings nicht.
PAZ: Die Deutschen hätten einen seltsamen Hang zur Fernstenliebe, bemerkte einst Pater Basilius Streithofen. Falls Sie zustimmen, woher kommt der?
Dirsch: Das erscheint mir doch etwas zu generell. Zweifellos ist diese Strömung eine Frucht der schon vorhin erwähnten Dauerfixierung auf das Dritte Reich. Der berühmte Umschwung des Pendels in sein Gegenteil ist als psychologischer Hintergrund evident. Wir kennen den berühmten Satz von Winston Churchill, der den deutschen Nationalcharakter einmal sarkastisch umrissen hat: „Man hat die Deutschen entweder an der Gurgel oder zu Füßen.“ Da ist schon etwas dran. Und der aktuelle Pendelausschlag führt heute in manchen Kreisen dazu, die ganze Welt mit den Botschaften eines grenzenlosen Humanitarismus beglücken zu wollen. Nein, Fernstenliebe ist kein Ausfluss der christlichen Ethik, das ist die Nächstenliebe. Bereits der Heilige Augustinus verwies darauf, dass auch das Liebesgebot einer Abstufung unterliege. Er plädierte für die Bevorzugung derer, die „gleichsam durch ein gewisses Los enger verbunden sind“. Die Art der Beziehung, die in vielen Familien selbstverständlich ist, lässt sich nicht einfach auf die Menschheit übertragen. Das verbieten schon praktische Gründe.
PAZ: Der Präsident des evangelischen Kirchentages, Hans Leyendecker, hält die Ausgrenzung der AfD für notwendig, das heißt, ihre Politiker sind beim Kirchentag nicht willkommen. Scheut man sich da vor einer öffentlichen Auseinandersetzung mit der größten deutschen Oppositionspartei?
Dirsch: Zunächst einmal ist diese „Ausgrenzeritis“ im „Kampf gegen Rechts“ ein Ausdruck von Zeitgeist-Konformismus. Leyendecker meint also, weil viele Kreise in der Öffentlichkeit die AfD ausgrenzen, müsse er das als Kirchentagspräsident auch tun. Auftrittsverbote sind natürlich leichter zu vollziehen als sich mit Gegenpositionen in offener Feldschlacht der Worte zu stellen. Insofern ist Leyendecker eine Art hoher Priester der etablierten Diskurshoheit, was eigentlich so gar nicht zum liberalen Image seiner „Süddeutschen Zeitung“ passt. Das wollten wir in unserem Buch anders gestalten. So haben wir es einerseits vermieden, die AfD als christliche Partei zu bezeichnen, weil sie das nicht ist. Aber andererseits arbeiten wir anhand vieler Belege heraus, dass es in dieser Partei christliche Einsprengsel gibt, und wenn man genau hinschaut, hat die AfD mehr christliche Elemente als andere Parteien.
PAZ: Woran machen Sie das fest?
Dirsch: Beispielsweise das Engagement der meisten Mitglieder gegen die Homo-Ehe, gegen Gender-Mainstreaming, gegen Abtreibung. In der aktuellen Debatte ist die Beibehaltung des Werbeverbots für Abtreibungen die Nagelprobe. Und von daher ist die Positionierung der AfD als Gesamtpartei völlig klar und das muss hervorgehoben werden, auch wenn es hier einzelne Abweichungen gibt, die in jeder Gruppe oder Partei vorkommen. Selbst die etwas säkular ausgerichteten AfD-Parteimitglieder sind beispielsweise für die Beibehaltung des Werbeverbots für Abtreibungen. Auch der viel umstrittene Björn Höcke aus Thüringen, der sich ja als Agnostiker bezeichnet und sich explizit zu dieser Frage noch nicht geäußert hat, steht sicher auf der Seite des Lebensschutzes. Wobei man sagen muss: Gegen die Tötung der Schwächsten und Wehrlosesten zu sein, bedarf keines christlichen Glaubensbekenntnisses, das ist wahrer und an sich selbstverständlicher Humanismus. So sollte es zumindest sein.
PAZ: Aber warum scheut man sich vor der öffentlichen Auseinandersetzung mit der AfD beim Kirchentag, wenn man doch mit eigenen Argumenten diese Partei in die Schranken weisen könnte?
Dirsch: Selbst wenn man der AfD im öffentlichen Disput Paroli bieten könnte, man scheut sich offenbar davor, ihr überhaupt ein Podium für ihre Argumente anzubieten. Das hängt zum Teil sicher mit einem Phänomen zusammen, das Elisabeth Noelle-Neumann in ihrem Buch „Die Schweigespirale“ schon in den 1970er Jahren beschrieben hat. Der Mensch hat wohl eine soziale Haut. Er möchte nicht isoliert sein, und wenn jemand gegen den Strom schwimmt, viele NS-Gegner haben das leidvoll erfahren müssen, dann schafft man sich häufig große Probleme. Man lebt nämlich weniger ruhig, als wenn man stromlinienförmig im rot-grünen Mainstream mitmarschiert.
PAZ: Sprichwörtlich heißt es ja, wo Gefahr ist, ist das Rettende auch. Haben Sie eine frohe Weihnachtsbotschaft für unsere Leser parat?
Dirsch: Ja, es ist eine Botschaft, die seit ewigen Zeiten gilt: Unsere Hoffnung gründet nach wie vor darauf, dass Gottes Sohn auf die Welt gekommen ist. Es gab nie eine größere Hoffnung als das Geschenk Gottes an die Menschen, und es wird auch nie ein größeres Geschenk geben als das.
(siehe Buchbesprechnung S. 22)