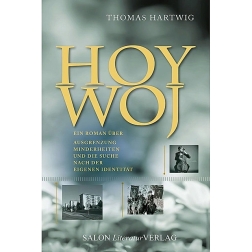Geboren wurde ich 1939 in Rastenburg. Mein Vater stammte aus Schippenbeil und war Lehrer und Schulleiter einer örtlichen Mittelschule, die im April 1939 gegründet worden war und die er aufbauen sollte. Meine Mutter war gebürtig aus Szierandzen im Kreis Insterburg und ebenfalls als Mittelschullehrerin am Hindenburg-Oberlyzeum vor Ort tätig. Ende August 1939 war mein Vater eingezogen worden, um am beginnenden Polen-Feldzug teilzunehmen, und so war er bei meiner Geburt nicht anwesend. Im März 1941 wurde mein Vater aus der Wehrmacht entlassen und konnte sich wieder seiner Lehrtätigkeit widmen, doch nach rund eineinhalb Jahren kam erneut der Einberufungsbefehl.
1942 wurde mein Bruder geboren. Wenig später kam ich in den Kindergarten, wo ich als erstes lernte, dass man bei der Begrüßung nicht „Guten Morgen“ sagte, sondern „Heil Hitler“. Auch an unsere damalige Wohnung kann ich mich noch erinnern, die ich nach 53 Jahren (1998) wiedersah, als es uns durch Vermittlung eines polnischen Freundes und der Zustimmung der seinerzeitigen Mieterin gelang, sie erneut zu betreten. Im Sommer fuhr meine Mutter mit uns Kindern nach Cranz, wo wir das Strandleben genossen. Noch beim letzten Aufenthalt im Sommer 1944 herrschte eine friedliche Idylle, denn vom Krieg spürten wir nichts, obwohl nur kurze Zeit danach britische Bomber Königsberg in Schutt und Asche legten und nur wenige Wochen später die Rote Armee vor den Toren Ostpreußens stand.
Die Ruhe vor dem Sturm
Am 26. November 1944 (Totensonntag) hatte es im Keller unseres Hauses einen Einbruch gegeben, bei dem die dort deponierten Luftschutzkoffer aufgebrochen und Tafelsilber sowie Kleidungsstücke entwendet wurden. Auch Lebensmittelvorräte hatte man gestohlen, wobei die ermittelnde Kriminalpolizei zu dem Schluss kam, dass es sich bei den Tätern vermutlich um Soldaten gehandelt habe. Meine Mutter war entsetzt und schrieb ihrer Schwägerin in Nordenburg, offensichtlich werde nun schon aller Privatbesitz als Allgemeingut betrachtet. Und sie stellte die verzweifelte Frage: „Wie wollen wir dann den Krieg gewinnen?“ Genau sechs Wochen später begann die sowjetische Großoffensive, die bald zum Inferno für die ostpreußische Zivilbevölkerung werden sollte.
Am 27. Januar 1945 wurde Rastenburg von der Roten Armee eingenommen. Kurz zuvor waren wir – viel zu spät, wie sich bald herausstellte – auf die Flucht gegangen. Meine Mutter war mit uns beiden Kindern zu einem Gutsbesitzer in der Nähe aufgebrochen, dessen Ehefrau eine Schulfreundin meiner Mutter war und der versprochen hatte, uns mitzunehmen. Bei minus 20 Grad und heftigen Schneestürmen begaben wir uns auf den Weg Richtung Westen. Wir kamen nur langsam voran, immer die Sowjets im Rücken, deren Tiefflieger die Flüchtlingskolonnen mit ihren Bordkanonen beschossen. Noch heute sehe ich vor meinen Augen die im blutgetränkten Schnee liegenden toten Pferde und erfrorene Kinderleichen.
Als Brandlöscher in Rastenburg
Dass es uns nicht auch erwischte, lag wahrscheinlich daran, dass die gegnerischen Soldaten unseren Treck bald eingeholt und überrollt hatten. Wir wurden gezwungen umzukehren, denn am 31. Januar hatten die Besatzer die bis dahin weitgehend unversehrte Stadt Rastenburg in Brand gesetzt, der nun von den zurückgetriebenen Bewohnern gelöscht werden sollte. Bei der Ankunft mussten wir feststellen, dass inzwischen alle Wohnungen geplündert worden waren. Aber die verbliebenen Deutschen durften ohnehin nicht mehr in ihre Wohnungen zurück, sondern wurden in einem abgetrennten Ghetto zusammengepfercht. So konnten deren verlassene Wohnungen in der Stadt weiter in Ruhe „ausgeräumt“ werden.
In den provisorisch hergerichteten Unterkünften mussten sich oft bis zu 30 Personen ein Zimmer teilen, und ich weiß noch, dass man die Privatsphäre der Menschen dadurch zu wahren versuchte, dass man Betttücher oder große Stofflaken mitten in den Zimmern aufhängte, um sein kleines persönliches Areal mit den wenigen Habseligkeiten, die einem geblieben waren, abzugrenzen. Das Sammellager selbst wurde rundherum von sowjetischen Soldaten bewacht.
Jeden Morgen hatten sich vor der Kommandantur Frauen und junge Mädchen einzufinden, die man zu Aufräumarbeiten abkommandierte. Diese Arbeitskolonnen wurden dazu eingesetzt, Privateigentum aus den verwaisten Wohnungen wegzuschaffen, das die Besatzungsmacht im Sinne von Reparationsleistungen beschlagnahmte. Alte Leute und Kinder blieben derweilen zurück und konnten froh sein, wenn ihre Angehörigen abends zurückkehrten, was häufig nicht der Fall war, weil sie tagsüber spurlos verschwanden.
Unter Lebensgefahr gelang es hin und wieder einigen Frauen, in unbeaufsichtigten Momenten Medikamente und Verbandsmaterial aus den geplünderten Häusern und Arztpraxen zu holen, um es für Erste-Hilfe-Situationen zu reservieren. Auch meine Mutter verließ uns regelmäßig morgens zum Arbeitseinsatz, und wir konnten von Glück sagen, wenn wir sie abends wiedersahen.
Ende Februar 1945 begannen die ersten Verschleppungen, am Gründonnerstag (29. März) erfolgte die umfangreichste Verhaftungswelle. Schließlich erwischte es auch meine Mutter: Am Karsamstag
(31. März) oder Ostersonntag (1. April) kam sie abends nicht zurück. Sie war auf dem Weg zur Arbeit oder während der Arbeit festgenommen und zum Verhör durch den sowjetischen Geheimdienst gebracht worden. Solche Vernehmungen fanden meist im Keller eines Hauses statt und dauerten mehrere Tage, an denen man dort in Dunkelheit bei Wasser und trockenem Brot ausharrte. Nicht selten waren die Prozeduren begleitet von Folter oder Vergewaltigungen. Wer in der NSDAP gewesen war, wurde per Lastwagen nach Insterburg verfrachtet, wo die Unterbringung im ehemaligen Zuchthaus erfolgte, das man jetzt für die zum Abtransport vorgesehenen Personen als Straflager nutzte.
Zwar ist mir über eine Parteimitgliedschaft meiner Mutter nichts bekannt, da sie aber zu der Gruppe der Deportierten zählte, muss wohl davon ausgegangen werden; außerdem hatte sie als Lehrerin ja im Staatsdienst gestanden, und da war ein Eintritt in die NSDAP keine Seltenheit, sondern stellte eher einen Vorteil dar. Auch eine Freundin meiner Mutter, die mit ihren zwei kleinen Kindern und ihrer Mutter in unserem Sammellager untergebracht war, kehrte eines Tages nicht vom Arbeitseinsatz zurück, doch hatten diese beiden Kinder das Glück, dass wenigstens noch ihre Großmutter blieb, die sich um sie kümmern konnte. Und weil die alte Dame Mitleid mit meinem Bruder und mir hatte, sorgte sie auch für uns, soweit das möglich war. Das hat uns mit Sicherheit das Leben gerettet, denn entweder wären wir in einem Waisenhaus geendet oder als „Wolfskinder“ durch die Gegend geirrt, von denen es gerade in Rastenburg etliche gab.
Feindlich gesinnte Polen
Nach Kriegsende übergaben die Sowjets den Polen die Verwaltung. Damit entfiel auch die Bewachung unseres Ghettos durch die Posten der Roten Armee, wodurch die Deutschen den Schikanen der anfänglich sehr feindselig auftretenden polnischen Bewohner ausgesetzt waren. Im September 1945 begann die Vertreibung der deutschen Bevölkerung Rastenburgs, im Oktober mussten nahezu alle ihre Heimat verlassen und wurden in die sowjetisch besetzte Zone deportiert. Auch wir gehörten dazu und hatten Glück, dass die alte Dame, die seit der Verschleppung ihrer eigenen Tochter sowie unserer Mutter vier kleine Kinder versorgt hatte, auch meinen Bruder und mich mitnahm. Da sie wusste, dass die Schwester unserer Mutter, mit ihrer Familie in Thüringen lebte, benachrichtigte sie in Berlin das Deutsche Rote Kreuz (DRK), das einen Transport zu unseren Verwandten organisierte. Uns hatten inzwischen zahlreiche Krankheiten geplagt, und so erreichten wir dreckig und in verlauster Kleidung unser neues Zuhause.
Unser Vater kehrte im Juli 1947 aus französischer Kriegsgefangenschaft zurück, in die er im April 1945 geraten war. Im April 1946 hatte ihn ein erster Brief mit Nachrichten über das Schicksal seiner Familie erreicht. So wusste er, wo wir waren und dass wir uns in Sicherheit befanden. Im Sommer 1947 gab es ein Wiedersehen mit ihm. Da mein Vater so schnell wie möglich den sowjetischen Machtbereich verlassen wollte, siedelten wir schon bald zu Verwandten nach Schöningen (bei Helmstedt) über, wo wir bis 1949 blieben. Dann erhielt mein Vater eine Anstellung als Lehrer in der Nähe von Bonn.
Unsere Mutter blieb vermisst. Aufgrund von Anzeigen im Ostpreußenblatt meldeten sich Anfang der 1950er Jahre zwei ehemalige Leidensgenossinnen, die berichteten, dass am 18. April 1945 rund 1400 Frauen, unter denen sich auch unsere Mutter befand, am Güterbahnhof in Insterburg auf Viehwaggons verladen und in ein Straflager im Ural deportiert worden waren. Da unsere Mutter schwer erkrankte, sollte sie im September des Jahres entlassen werden, war aber am Tag des geplanten Rücktransports ohnmächtig zusammengebrochen. Die beiden Lagerinsassinnen konnten dagegen die Rückreise antreten, waren sich in ihren Schilderungen jedoch einig, dass unsere Mutter keine Überlebenschance gehabt habe und dort verstorben sei. Ähnlich äußerte sich der Suchdienst des DRK 1952 in einem Schreiben an unseren Vater, in dem es hieß, dass unsere Mutter zuletzt im Oktober 1945 lebend gesehen worden sei, weshalb man als Zeitpunkt des Todes den 31. Dezember 1945 festsetze. Eine offizielle Bestätigung für den Tod erhielten wir allerdings nicht, sodass das Schicksal unserer Mutter weiterhin ungeklärt blieb. Es vergingen noch Jahre, bis unser Vater nicht mehr daran glaubte, dass unsere Mutter noch lebte, und so beantragte er schweren Herzens, seine Frau für tot erklären zu lassen, was 1959 offiziell geschah.
Erst der Zusammenbruch des Kommunismus in Osteuropa und die damit verbundene Öffnung der Grenzen weckten Hoffnungen, viele der bis dahin ungelösten Schicksale noch zu klären, und so wandten wir uns in den Jahren 1994/95 mit Anfragen sowohl an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge als auch an den Suchdienst des DRK, die schließlich zum Erfolg führten. 1997 erhielten wir die Nachricht, dass unsere Mutter am 14. September 1945 im Lager verstorben war. Damit erhielten wir nach mehr als einem halben Jahrhundert endlich Gewissheit über ihr Schicksal. Unser Vater, 95 Jahre alt, lebte zu dem Zeitpunkt noch. Im Sommer 2011 erhielten wir vom Suchdienst des DRK dann noch überraschend eine Kopie der vollständigen Sterbe- und Begräbnisakte unserer Mutter, die zwischenzeitlich vom Staatlichen Russischen Militärarchiv aus Moskau übermittelt worden war.Gertraud Reith geb. von Mioduszewski, früher Rastenburg, heute Neuss und Kapstadt